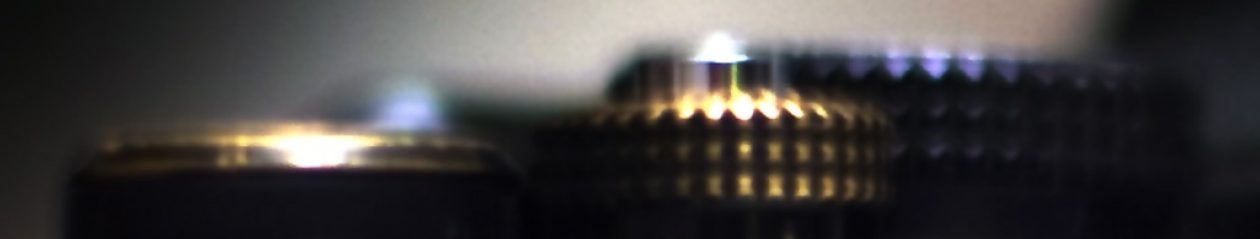Wir haben nicht immer die richtige Wahl
Wir haben nicht immer die richtige Wahl, aber eine Wahl haben wir immer. Zu Studienzeiten lebte ich eine Weile in einem abrissreifen Haus mit drei sympathischen, aufgeweckten Menschen in einer Wohngemeinschaft. Eines Tages spazierte ein in unserem Universitätsstädtchen wohlbekannter Professor an unserer WG vorbei. Er war ein sehr linker, sehr belesener, sehr kluger, sehr lauterer und sehr mutiger Mensch.

Exakt diese Kombination ist, vorsichtig gesprochen, eher selten, gerade unter Professoren. Obendrein war er humorvoll und aufgeschlossen. Vielleicht war sein Humor ein wenig … trocken, doch die Präzision und die Verständlichkeit seiner Worte (gesprochen wie geschrieben) wurde von wenigen erreicht. Er war intellektuell außergewöhnlich sauber. Auch Menschen, die seine politischen Ansichten nicht teilten, und das waren die meisten, konnten (und können) mit seinen Beobachtungen und Analysen deshalb etwas anfangen.
Jener Professor, den ich, wie unschwer zu erkennen ist, sehr schätze, spazierte also an unserer Bruchbude vorbei. Ich war nicht daheim, aber Frank, mein Mitbewohner. Er erzählte mir, dass Professor Fülberth stehen blieb, lachte, einen Fotoapparat zückte und unser Haus (wenn man es denn so nennen wollte) fotografierte. Es war 1989, Europa-Wahlkampf, und wir hatten, in erster Linie für die benachbart lebenden Burschenschafter, ein altes Betttuch zum Transparent umfunktioniert: «Wir wählen DKP – aber nur, um die Grünen zu ärgern».
Damals zogen die rechtsradikalen Republikaner ins Europaparlament ein. (Die Welt ging nicht unter, aber ein besserer Ort wurde sie gewiss nicht.)

Heute, 28 Jahre später, wurde erstmals die AfD, deren Führungspersonal mit Hitlerbart im Schambereich herumläuft, in den Bundestag gewählt, von einer Wählerschaft, die zu 95% aus Ressentiment und zu 100% aus Angst so wählte. Ich habe heute, in Erinnerung an unser Betttuch und Professor Fülberth, der lange Jahre für die Deutsche Kommunistische Partei im Marburger Stadtrat saß, die Linken gewählt. Wir haben nicht immer die richtige Wahl, aber eine Wahl haben wir immer.
Gegen das Insektensterben
Vergangenen Sonntag auf unserer Terrasse.



Ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang
Seit zwölf Jahren arbeite ich als angelernte Kraft in dieser Bibliothek. Jetzt bezahlt mein Arbeitgeber mir eine berufsbegleitende Ausbildung im Bibliotheksbereich. Das ist fantastisch, denn es heißt, dass ich nach einem vor ewigen Zeiten abgebrochenen Studium und einem Arbeitsleben in verschiedenen „prekären Jobs“ nicht nur ein Auskommen im Öffentlichen Dienst gefunden habe, sondern endlich in den Genuss einer abgeschlossenen Berufsausbildung kommen könnte.
Nachdem ich bereits vor längerer Zeit aus einem – nicht uninteressanten – Leben am Rande der Gesellschaft ein wenig mehr in ihr Zentrum gewandert bin (eine Reise, zu der es für mich irgendwann keine Alternative gab), ist die staatliche Prüfung zum FaMI eine Art Zieleinlauf in ein „normales Berufsleben“. Auch wenn üblicherweise die Ausbildung vor der Berufstätigkeit kommt.
Wenn ich die Prüfung denn schaffe.
Denn als ich mich auf dieses Abenteuer einließ, habe ich eins nicht bedacht: wie schwer es fällt, nach Jahrzehnten des Nicht-Mehr-Lernens wieder die Schulbank zu drücken. Es ist nicht so, dass ich die Inhalte nicht verstünde… ich vergesse sie. „Begreifen“ ist nicht das Problem, das Problem ist „Behalten“. Bzw. eben nicht. Tatsächlich eine beängstigende Erfahrung, auch wenn mir alle in meinem Alter sagen, das sei normal.
Doch ich bekomme viel Unterstützung. Von meiner Frau, die mir den Rücken freihält. Von Freunden. Meine Vorgesetzten haben trotz schwieriger Personalsituation zugestimmt, dass ich während der Ausbildung Teilzeit arbeite, damit ich Zeit zum Lernen habe. Und die Kolleginnen, die mein Fehlen auffangen müssen, beklagen sich nicht bloß nicht, sondern ermutigen mich.
Vielen Dank, Euch und Ihnen allen!
Ob ich die Prüfung schaffe ist nicht sicher. Es ist ein Abenteuer. Mit ungewissem Ausgang. Aber ich tue was ich kann. Versprochen.
Was ist bloß los mit uns? Beinahe ein Kommentar zum G-20-Gipfel
Eigentlich will ich auf dieser Seite nicht viel. Über Fotografie schreiben, eigentlich. Ab und zu auch Fotos zeigen, natürlich nur solche, mit denen ich meine Privatheit nicht riskiere. Eigentlich nichts Politisches äußern. Denn ich glaube nicht, dass meine Stimme in einer öffentlichen Auseinandersetzung Gewicht hat.
Eigentlich.
(Natürlich bin ich auch aus Bequemlichkeit unpolitisch. Aber man ist ja nicht verpflichtet, etwas zu tun, das nichts bringt, nur weil es bequem ist, es nicht zu tun.)
Ab und zu jedoch muss ich mich in der seltsamen Halböffentlichkeit meiner Homepage einfach politisch äußern – obwohl ich weiß, dass sie nicht gelesen wird. Vielleicht, weil ich schlecht in den Wald gehen und laut schreien kann?
Zum Beispiel, dass ich Antisemiten für widerliches Pack halte – das musste hier ja schon öfter raus. Und ich sag’s gleich nochmal: sie sind ein widerliches Pack, überall. Hier bei uns in Deutschland sind sie wahlweise am abgefeimt-bösartigsten oder aller-aller-dümmsten. Oh, natürlich auch in der Ostmark Österreich, dieser Anschluss hält bis heute. Ja, ich weiß, es wird nichts ändern, aber es tut gut, das zu sagen, und es schadet niemandem, wenn ich auf meiner eigenen Homepage mal die Klappe aufreiße. Leider auch nicht den Antisemiten …
… Die britische Luftwaffe, las ich irgendwo, habe die einzige Aufklärung durchgeführt, die in Deutschland je stattgefunden habe. Und manchmal, besonders nach Lektüre von F.A.Z.- Leserkommentaren, möchte ich dem in einer Art Ekel zustimmen. Natürlich rufe ich mich dann ganz schnell zur Ordnung: Ich weiß, dass der Zweite Weltkrieg noch bei uns Heutigen Spuren hinterlassen hat. Wir sind Überlebende einer Katastrophe, die vor unserer Geburt stattfand.
Ich weiß aber auch, dass der Bombenkrieg von damals das Beste war, das den Braunen von heute geschehen konnte. Pseudolegitimiert das sinnlose Leid, das Millionen Deutschen damit zugefügt wurde, doch allzu schön ihre zuvor verübten Greueltaten: „Die andern haben aber auch“. Schon. Aber „wir“ haben angefangen. (Heul‘ doch, Neonazi. Nur hör auf, auf die Würde der Opfer zu spucken – aller Opfer.)

Doch obwohl dieses Elendskapitel der Geschichte noch immer nicht ganz abgeschlossen ist (warum sonst z.B. die gefährlichen Animositäten zwischen EU und Russland?), wirken wir alle längst an ganz neuen. Denn wir ziehen, als Spezies, kollektives Vergessen vor. „Wir lernen schon in Geschichte, dass wir nichts aus Geschichte lernen.“ So ungefähr äußerte sich mein Geschichtslehrer vor etwa 40 Jahren. Da kannte ich Hegel noch nicht, darum fand ich das Zitat originell. („Hegel“ kenne ich auch heute noch nicht, bloß ein paar Zitate. Es reicht, meinem Lehrer Zitateklau nachzuweisen.) Bis heute weigere ich mich, diesem Satz zuzustimmen. Doch je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir.
Es gibt so viele neue Krisen- und Kriegsgebiete, es gibt so viele wirtschaftliche, politische, religiöse, kulturelle Konflikte, es gibt die schlimmsten Anzeichen, dass das ökologische Gleichgewicht weltweit irreversibel gestört ist …
Und was ist los? Wir sehen wieder nicht hin. Wir ziehen es vor, die kommenden Katastrophen kommen zu lassen. Nicht nur die alten und aktuellen, sondern auch die zukünftigen Katastrophen zu ignorieren. Die jetzt noch mit vertretbarem Aufwand zu verhindern wären.
Eins allerdings ist dabei historisch neu: wir wissen es. Nie war eine Bevölkerung umfassender informiert als heute die der Industrieländer. Noch die Gräueltaten in den Kolonien konnten geschehen, ohne dass man es in den „Mutterländern“ unbedingt wissen musste. Heute ist das anders. Dennoch bleibt alles beim Alten:
Wir wissen beispielsweise, dass aktuell 17 Millionen Menschen in einer einzigen, lokalisierbaren, in Google Earth bequem von oben zu betrachtenden Region verdursten und verhungern. Es kam in allen Nachrichten, stand in allen Zeitungen, im März und April 2017. Und was geschah? Wir wandten uns ab. Wir lassen es geschehen, gerade jetzt. Obwohl wir auch wissen, was dagegen zu tun wäre. Sinnvolle Ersthilfe wäre finanziell weniger aufwendig als, sagen wir, der deutsche Militäreinsatz in Afghanistan. Das wissen wir. Und, tut wer was?
Ich vermute: Diese Art Wissen lähmt uns – alle. Ich denke, es macht die Menschen in den Industrieländern kollektiv, als Gesellschaften, psychisch krank. Das Schlimmste daran ist (in meinen Augen), dass es, zum ersten und vermutlich einzigen Mal in der Geschichte, möglich wäre, zumindest mit diesen selbst verursachten Katastrophen Schluss zu machen. Die fortgeschrittene Industrialisierung der Welt eröffnet ja die Möglichkeit, alle Menschen, nicht bloß die jeweils eigene Untergruppe, mit allem zu versorgen, das für ein gutes Leben nötig ist.
Es ist, anders als früher, nicht mehr nötig, sich gegenseitig abzuschlachten oder verhungern zu lassen; die je eigene Gruppe könnte fantastisch leben, ohne die benachbarten schädigen zu müssen. Anders als noch vor 150 Jahren leben wir in einer Überflusswelt, nicht in einer des Mangels. Doch weil wir den neuen Reichtum weiter nach den alten Mustern verteilen, werden uns die Spannungen zerreißen. Das ahnen wir in den reichen Gesellschaften. Obendrein fürchten wir, dass sie im Süden den Preis für den neuen Reichtum nicht mehr lange zahlen können. Deshalb die Neonazis, deshalb Trump, Le Pen, Putin, Orban, die Leserkommentare der F.A.Z … die aktuelle Katastrophenstimmung sogar, nein gerade, dort, wo es den Menschen besser geht als jemals zuvor. Wir klammern uns panisch an die alten Muster, die alten, vertrauten Ausbeutungsverhältnisse.
Und jetzt mit Pathos: In den Händen der Menschen des frühen 21. Jahrhunderts liegt der Schlüssel zum Paradies. Doch wir sind, allesamt, darauf konditioniert, uns an die negativen Muster zu halten, an denen schon unsere Vorfahren sich orientiert haben.
Also scheißen wir auf jede bessere Welt, solange es uns dafür in der schlechteren nur besser geht als anderen. Diese Grundhaltung wurde soeben auf dem G-20-Gipfel in Hamburg wieder einmal zementiert.
Darum kann ich mich nicht aufraffen zu politischer Betätigung. Und bleibe im Privaten. Andere, genauso sinnlos, aber medienwirksamer, machen aus dem gleichen Gefühl Randale im G-20-Hamburg. Nein, das ist definitiv auch nicht besser.
So. Jetzt hab‘ ich wieder eine Zeit lang Ruhe.
MFake America great again!
To fake: fälschen, fingieren.
Ich beanspruche hiermit das Urheberrecht für die obige Korrektur des Trump’schen Wahlmottos. Period.
Blickrichtung
Neulich einen Schnappschuss aus dem Zugfenster gemacht, unscharf, verwackelt, missglückt:

Ich kann nicht wirklich sagen, weshalb ich auf den Auslöser drückte. Ich weiß noch, dass ich in jenem Augenblick dachte „das wird eh nix“ und trotzdem auslöste. Was im Umkehrschluss heißt, dass ich ja irgend ein Ergebnis erwartet haben muss, im Vergleich zu dem das entstandene Foto „nix“ sein konnte.
Blöd nur – ich kann nicht sagen, was.
Das Foto war dann auch wirklich „nix“. Aber etwas veranlasste mich, es nicht zu löschen; stattdessen dunkelte ich es ab und intensivierte die Farben:

Das Resultat hatte definitiv nichts mehr gemein mit der wahrgenommenen Wirklichkeit. Erstaunlicherweise fand ich das so entstandene Bild plötzlich betrachtenswert. Es (man sollte nie die eigenen Fotos interpretieren) zeigte nun etwas von der schieren Kraft eines modernen Hochgeschwindigkeitszuges.
Ein Ausflug ins „Neue Frankfurt“
Das Neue Frankfurt ist nicht so neu: Zwischen 1925 und 1930 wurden für die notleidende Frankfurter Bevölkerung tausende neue Wohnungen errichtet, geplant unter Oberbürgermeister Ludwig Landmann von einem Stab um den 1925 zum Stadtbaurat ernannten Architekten Ernst May.

Insgesamt 26 Siedlungen sollten in den damaligen Außenbezirken der Stadt entstehen, nach neuesten architektonischen und technologischen Erkenntnissen. Erklärtes Ziel war, mit beschränkten kommunalen Mitteln möglichst vielen Menschen eine menschenwürdige Behausung zu schaffen. Das extrem ehrgeizige Projekt versammelte führende Köpfe der klassischen Moderne, darunter auch heute noch so bekannte Namen wie Walter Gropius, Margarethe Schütte-Lihotzky und Bruno Taut.
Letzterer war selbst federführend an einem vergleichbaren (weil aus einer gleichartigen Notlage entstandenen) Projekt in Berlin beteiligt, der Hufeisensiedlung. Sie genießt heute den Status als Weltkulturerbe. Vergangenes Jahr konnten meine Frau und ich dort einige Tage in einem „bewohnbaren Museum“ verbringen: Eines der Siedlungshäuser wurde von den Eigentümern aufwändig originalgetreu restauriert und wird seither als Ferienwohnung an interessierte Gäste vermietet. Unser Aufenthalt war eine Zeitreise. Wir hatten das Gefühl, unmittelbar in die späten zwanziger Jahre einzutauchen.
Seltsamerweise stellte ich mir damals nicht die Frage nach vergleichbaren Bestrebungen in anderen Städten, etwa meinem Geburtsort Frankfurt. Dabei hätte sie nahe gelegen: Bis zur Gründung von „Groß-Berlin“ im Jahr 1922 war Frankfurt die flächenmäßig größte Stadt im Deutschen Reich und hatte mit Berlin vergleichbare Probleme, Arbeitslosigkeit, Verelendung, Wohnungsnot. Tatsächlich sind auch die Lösungswege vergleichbar, die in beiden Städten beschritten wurden.
Ende April unternahmen wir einen Ausflug in zwei der bestehenden Siedlungen des „Neuen Frankfurt“: die Römerstadt und die Hellerhofsiedlung. Von Mainz aus ein bisschen näher als Berlin… Trotz der unterschiedlichen Entwicklung der Siedlungen in Berlin und Frankfurt in den vergangenen neunzig Jahren ist die gemeinsame ideelle Grundlage deutlich sicht- und spürbar.
Hier einige Aufnahmen aus einem der Einfamilien-Reihenhäuser in der Römerstadt, dem Ernst-May-Haus. Es wurde von der ebenfalls nach May benannten Gesellschaft restauriert und ist als Museumshaus auch von innen zu besichtigen – für uns natürlich eine schöne Gelegenheit, einen Vergleich mit dem „Tauten Heim“ in der Hufeisensiedlung zu ziehen.
Viele Häuser der Siedlung Römerstadt werden übrigens noch von Nachkommen der ersten Mieter bewohnt; die zuständige städtische Wohnungsbaugesellschaft hält sich noch immer an die mit den Erstmietern geschlossenen Erbmietverträge. Auch dies ein Unterschied zur Berliner Hufeisensiedlung.
Die einst in alle Häuser der Siedlung Römerstadt eingebaute, weitgehend restaurierte „Frankfurter Küche“ der Architektin M. Schütte-Lihotzky:
Was mich bei dem Besuch in Frankfurt ebenso berührte wie ein halbes Jahr zuvor in Berlin, konnte ich zunächst nicht in Worte fassen, dabei ist es im Grunde einfach: Die Häuser und Siedlungen des „Neuen Frankfurt“ faszinieren wie jene der Hufeisensiedlung durch die Konsequenz, mit der ein über das rein Architektonische hinaus weisender, umfassender Ansatz für Wege aus dem damaligen Massenelend gesucht wurde.
Nach nur fünf Jahren, im Jahr 1930, gab die Stadt ihr Projekt „Neues Frankfurt“ infolge der Weltwirtschaftskrise wieder auf. Von den geplanten 26 Siedlungen wurden nur 12 verwirklicht. Statt für 20000 Menschen und mehr konnte bloß für etwa 10000 neuer Wohnraum geschaffen werden. Die ursprüngliche Zielgruppe, die Arbeiterschaft, brachte in der Krise zudem die geforderten Mieten nicht auf. So wurden viele der Siedlungswohnungen an Angestellte und Beamte vergeben, die Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre ebenfalls mit wirtschaftlicher Not zu kämpfen hatten. Auch dies ist mit der Entwicklung vergleichbar, die während der Weltwirtschaftskrise in Berlin stattfand.
Die nichtproletarischen Bewohner werden in diesen Krisenzeiten ebenso froh über die großzügigen Gärten gewesen sein wie ihre Nachbarn aus der Arbeiterschaft, hatten die Planer sie doch so bemessen, dass sie als Nutzgärten spürbar zur Versorgung jeder einzelnen Familie beitragen konnten – eine weitere Gemeinsamkeit mit Bruno Tauts Siedlungen in Berlin.
Gärten wie der hier gezeigte gehören bis heute zu jedem der Reihenhäuser in der Römerstadt. Das relativiert die für heutige Verhältnisse sehr bescheidene Anmutung der Siedlungsbauten beträchtlich: denn wer kann sich heute – mitten in Frankfurt – eines eigenen Gartens dieser Größe erfreuen?
Garten hinter dem Ernst-May-Haus
Bilder aus dem Ernst-May-Haus und von der Römerstadt: